„Anteil der echten Nutzerfinanzierung im Verkehr erhöhen“
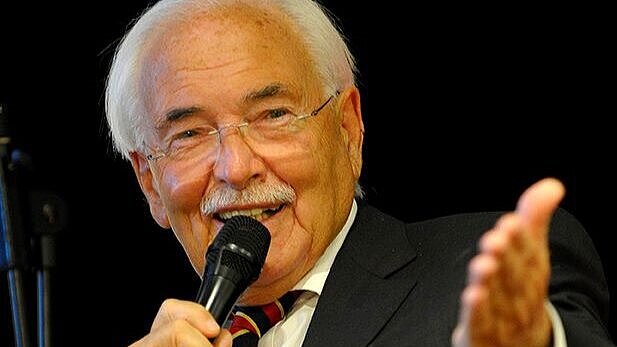
Prof. Dr. Rüdiger Sterzenbach
NaNa: Herr Sterzenbach, die Verkehrspolitik scheint im Bundestagswahlkampf keine Rolle zu spielen. Ist hier aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger alles im Lot, sodass die Politik das Thema ausklammern kann?
Rüdiger Sterzenbach: Leider nicht – sehen wir allein nur auf die Infrastruktur. Über mehrere Jahrzehnte hinweg wurde viel zu wenig in den Erhalt und die Modernisierung der Verkehrsinfrastruktur investiert. Dies gilt sowohl für die Schienenwege, die sich im Verantwortungsbereich der formal privatisierten Deutschen Bahn AG befinden, als auch für das Straßennetz, für das staatliche Behörden die Verantwortung tragen. Die politischen Rahmenbedingungen haben zu dieser Misere nicht unwesentlich beigetragen. Zum einen wurden zu lange Neubauprojekte gegenüber den Erhaltungsinvestitionen bevorzugt – hier ist zum Glück mittlerweile ein Umdenken zu beobachten. Zum anderen wurden Zusatzeinnahmen des Staates, insbesondere aus Nutzerentgelten, vielfach nicht zur Erhöhung der Investitionen genutzt. Stattdessen hat der Staat die zusätzlichen finanziellen Spielräume für eine Erhöhung seiner konsumtiven Ausgaben eingesetzt. Vor diesem Hintergrund sind die mitunter geforderten „Sondervermögen“, die durch eine zusätzliche Staatsverschuldung gespeist werden sollen, nur wenig hilfreich. Zu groß ist die Gefahr, dass der Staat auch hier die gewonnenen Spielräume an anderer Stelle zur Erhöhung des Staatskonsums nutzt. Wichtiger wäre es, den Anteil der echten Nutzerfinanzierung im Verkehr zu erhöhen und institutionell fest abgesichert für Unterhaltung und Erhalt der Infrastruktur zu verwenden. Zur Entlastung der Bürger und Unternehmen könnten die mit dem Verkehr in Verbindung stehenden und nicht zweckgebundenen Steuern reduziert werden.
NaNa: Sie laden für Ende März zu einem Kongress ein, bei dem Sie Wissenschaft, Politik und Branche zusammenbringen – und stellen dabei Diskurs und Kontroversen in den Vordergrund. Was ist Ihr Ansinnen mit der Veranstaltung?
Sterzenbach: Audiatur et altera pars – „Man höre auch die andere Seite“, so bei Hannah Arendt in „Wahrheit gibt es nur zu zweien“. Der Verkehr ist sowohl eine Voraussetzung für wirtschaftlichen Wohlstand und die Wahrnehmung persönlicher Freiheitsrechte als auch ein bedeutender Verursacher lokaler und globaler Umweltprobleme. Die mitunter erbittert geführten verkehrspolitischen Kontroversen und ihre vielfältigen Verknüpfungen sind für Beobachter vielfach kaum noch überschaubar. Der Kongress soll einen Beitrag zu einer objektiven und faktenbasierten Diskussion der vielfach geforderten Verkehrswende leisten. Vor dem Hintergrund einer umfassend verstandenen Nachhaltigkeit werden die zentralen verkehrsökonomischen Ziele, Strukturen und Handlungsoptionen erläutert und eingeordnet. Damit wird in dieser Form wohl erstmalig aus ökonomischer Perspektive ein fundierter Überblick sowohl über die Grundlagen als auch über die aktuellen Kernaufgaben der Verkehrspolitik in Deutschland vermittelt. Nach zweijähriger Recherche gemeinsam mit meinem Kollegen Frank Fichert von der Hochschule Worms wird im Frühjahr auch ein Buch zu diesem Themenfeld erscheinen, unsere Erkenntnisse bilden den Ausgangspunkt für den prominent bestückten Fachkongress.
NaNa: Aber ist das Risiko nicht viel mehr, dass die Politik die Geduld mit der Bahn verliert, der Klimaschutzaspekt ohnehin zurückgestellt und die Mobilitätswende abgesagt wird?
Sterzenbach: Es ist festzuhalten: Die Bundesregierung ist für das unternehmerische Handeln der DB AG verantwortlich, so das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2017. Die DB AG hat ihre Aufgabe der Verkehrsverlagerung auf die Schiene nicht erreicht. Das Unternehmen ist seit langem – sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in der Statistik – in der Qualität der angebotenen Produkte und in der Netzverfügbarkeit mangelhaft. Dieser Zustand hat sich dabei über einen längeren Zeitraum entwickelt. Es darf kein „weiter so“ in der Finanzierung der DB AG durch höhere Subventionen geben. Ultimaten an den Bahnvorstand zur Lösung der vielfältigen Probleme verkennen die Grundproblematik der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit des Staatskonzerns. Bevorzugungen durch geringere steuerliche Belastungen oder subventionierte niedrigere Fahrpreise oder ein denkbarer Billig- ICE lösen nicht das Grundproblem. Gleiches gilt für eine umgekehrt höhere Besteuerung der Alternativen zum Bahnfahren. Diese Maßnahmen spiegeln durch einen sich wiederholenden Aktionismus eher die Unkenntnis der primären Treiber einer Verkehrsverlagerung wider und sind zugleich ein Offenbarungseid der Politik. Aus meiner Sicht sind Netz und Betrieb strikt zu trennen. Das Netz ist außerhalb und ohne Einflussnahme der DB AG gemeinwohlorientiert vorzuhalten.
NaNa: Staat oder Markt: Wird das Pendel nicht alleine aufgrund der begrenzten Haushalte und neuer Prioritäten künftig wieder stärker in Richtung Markt und unternehmerischem Risiko ausschlagen müssen?
Sterzenbach: Vielfach wird den Bürgern der Glaube vermittelt, der Staat und die Politik könnten ökonomische Gesetze außer Kraft setzen und die Umsetzung von „Heilsversprechen“ garantieren. Preisbremsen oder Flatrates sind hier nur wenige Beispiele unter vielen. In der Politik wird zu häufig vernachlässigt, dass Innovationen und gute Produkte insbesondere dort zu erwarten sind, wo private Unternehmen im Wettbewerb agieren. Im Verkehrssektor gibt es leider eine lange Tradition staatlicher Wettbewerbsbeschränkungen – und die Akteure in den öffentlichen Betrieben wollen ihre Besitzstände auch nicht so einfach aufgeben. Das beste Lehrbuchbeispiel ist nach wie vor das in den 1930er-Jahren eingeführte Verbot des Fernbuslinienverkehrs, das ausschließlich dazu diente, die Reichs- beziehungsweise Bundesbahn vor Wettbewerb zu schützen. Die Marktöffnung Anfang der 2010er-Jahre hat hier zu einem kundenfreundlichen Angebot geführt und der Fernbus konnte sich seinen Marktanteil auch zulasten von Pkw-Fahrten erarbeiten. Auch in anderen Bereichen des Verkehrssektors ließe sich der Wettbewerb noch viel stärker nutzen, um innovative, kundenorientierte und effizient produzierte Angebote zu schaffen. Dies gilt etwa für den Schienenpersonenfernverkehr sowie für den ÖPNV, der für die Verkehrswende eine große Rolle spielt. Hier müssten geeignete Rahmenbedingungen allerdings teilweise erst geschaffen werden, konkret etwa in Form eines staatlich bereitgestellten Mobilitätsguthabens, mit dem die Bürger Verkehrsdienstleistungen bezahlen können. Dieses ließe sich nach sozialen Kriterien staffeln und schafft generell bei Verkehrsunternehmen einen marktwirtschaftlichen Anreiz zu innovativen und kundengerechten Angeboten. Die mitunter sehr kleinteilige und realitätsferne Angebotsfestlegung durch die Verkehrsbürokratie wäre dann weitgehend entbehrlich.
Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.
